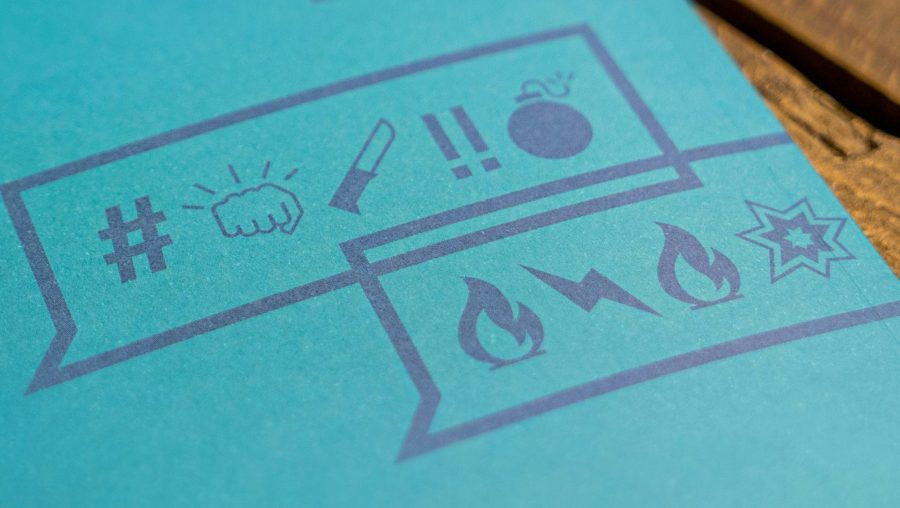Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) revolutioniert zahlreiche Branchen und birgt gleichzeitig rechtliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Urheberrecht. Früher waren normale Nutzer häufig Zielscheibe von Abmahnungen und Klagen wegen banaler Urheberrechtsverletzungen. Heute scheinen sich finanzkräftige Unternehmen frei für ihr KI-Training zu bedienen, ohne die Rechte der Urheber zu beachten. Dies wirft die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, KI-Modelle ohne Verletzung des Urheberrechts zu entwickeln.
Autor: Mariya Popova
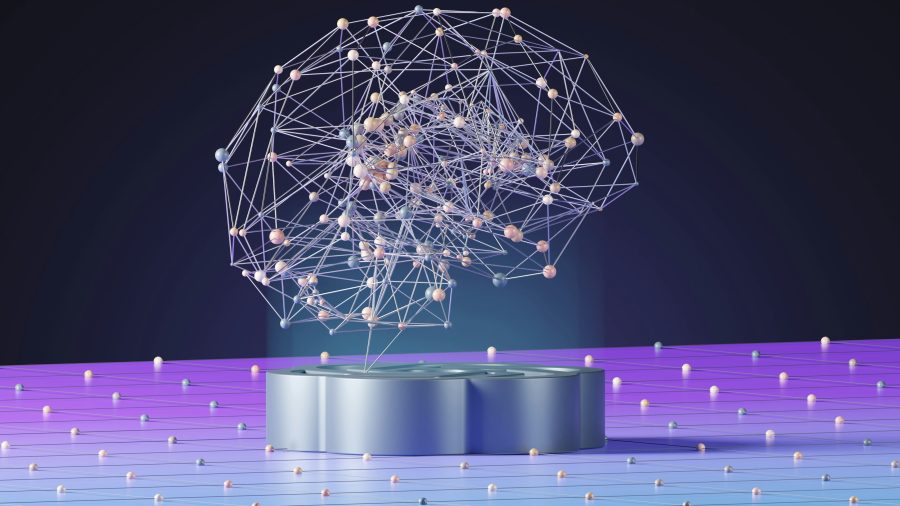
Letzte Woche stimmten die Abgeordneten des EU-Parlaments mehrheitlich für eine neue Regelung: das weltweit erste KI-Gesetz. Demnach sollen künftig KI-gesteuerte Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt und entsprechend reguliert werden. Können wir uns nun beim Umgang mit KI entspannt zurück lehnen?
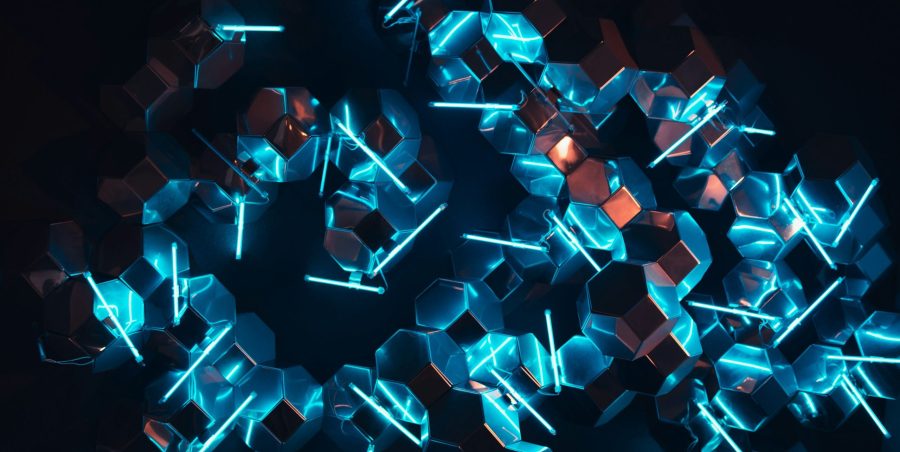
Der EuGH beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren immer wieder mit der Frage unter welchen Voraussetzungen ein immaterieller Schadensersatz bei Datenschutzverstößen zulässig sein soll. Letztes Jahr erteilte er in zwei wegweisenden Urteilen zunächst der Erheblichkeitsschwelle eine Absage und ließ später bereits die Befürchtung eines Datenmissbrauchs für einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz ausreichen. In seinem aktuellen Urteil bestätigt der Gerichtshof seine vorangegangenen Entscheidungen und engt die Anforderungen ein, indem er einen Anspruch aufgrund eines rein hypothetisches Risikos ablehnt.

Im Frühling diesen Jahres läuft neben der Frist für die nationale Umsetzung des DSA auch die einer weiteren bedeutenden EU-Verordnung aus. Bis zum 06.03.2024 müssen Gatekeeper ihre Pflichten aus dem Digital Market Act (DMA) umgesetzt haben. Dieses Wettbewerbsgesetz stellt sicher, dass einzelne Unternehmen nicht durch die „Torwächter“ behindert werden. Google informierte seine Nutzer bereits über zukünftige Änderungen.

In knapp einem Monat, am 17. Februar, tritt der Digital Services Act allumfänglich in Kraft. Bisher waren nur sehr große Plattformen und Suchmaschinen von der EU-Verordnung betroffen. Jedoch hagelt es seit dem Inkrafttreten im November 2022 Kritik. So soll bisher nicht nur die Beachtung der Rechtspflichten durch die großen Unternehmen sehr spärlich sein, sondern auch die Einhaltung der Umsetzungsfrist bis Februar 2024 in einigen EU-Mitgliedstaaten wohl nicht möglich sein.

In einer Welt, in der künstliche Intelligenz immer mehr in den Alltag integriert wird, stellen visuell generative KI-Modelle wie Midjourney und Dall-E 3 nicht nur technologische Durchbrüche dar, sondern werfen auch ernsthafte rechtliche Bedenken auf. Besonders in Bezug auf die nahezu unveränderte Reproduktion von Szenen aus Filmen und Serien könnten solche Technologien Nutzern erhebliche juristische Probleme bescheren.

In einem aktuellen Urteil stärkte der EuGH die Rechte des Verbrauchers für den Fall eines Hackerangriffs. Künftig soll bereits die Befürchtung eines Datenmissbrauchs für die Geltendmachung von immateriellem Schadensersatz bei einer Verletzung der Rechte aus der DSGVO ausreichen. Außerdem werden Unternehmen die gehackt wurden, in der Regel nicht mehr vorbringen können, schuldlos an einem Hack ihrer Systeme zu sein.

Das Internet hat das Einkaufsverhalten revolutioniert, indem es uns ermöglicht Produkte und Dienstleistungen anhand von Bewertungen anderer Verbraucher zu bewerten. Sternebewertungen sind zu einem entscheidenden Element geworden, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Doch wie transparent müssen Unternehmen bei der Verwendung solcher Bewertungen sein?

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung zweier Verbraucherkanzleien hat aufgedeckt, dass beinahe alle deutschen Mobilfunkanbieter über Jahre hinweg Kundendaten ohne Zustimmung der Kunden an die Schufa weitergeleitet haben. Dies hat nun eine mögliche Klagewelle gegen die Telefongesellschaften ausgelöst. Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass unrechtmäßig Handydaten von Millionen von Verbrauchern gespeichert wurden.
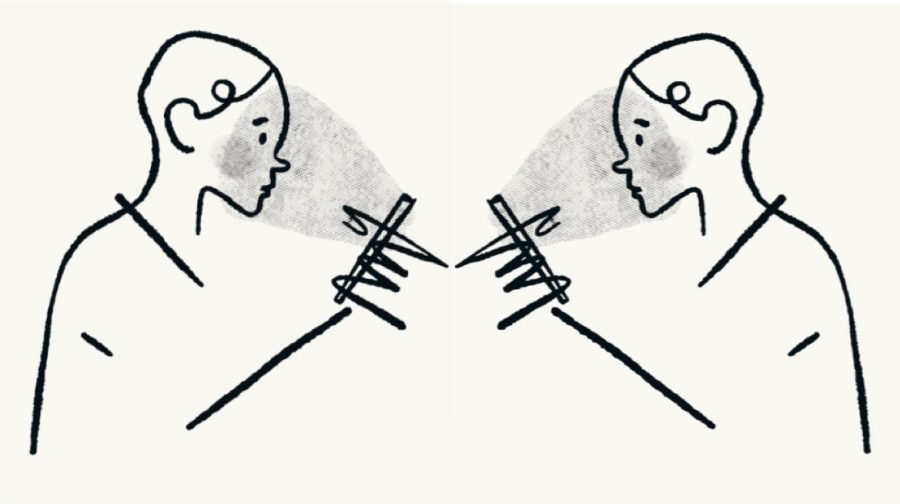
Und weiter geht es in der Welt der neuen Technologien: Nachdem sich unser letzter Beitrag mit Gesichtserkennungstechnologien befasst hat, folgen nun News zu Deepfakes. Bei Deepfakes geht es um die Erstellung von Klonen mittels künstlicher Intelligenz. Doch wer nun bei Klonen gleich an das Schaf Dolly denkt, täuscht sich. Vielmehr geht es um die Fälschung und Erstellung von Identitäten in Videos, Tonaufnahmen oder Texten. Derzeit kursiert in den deutschen Medien ein Video des Nachrichtensprechers Christian Sievers, indem der Sprecher in den Heute-Nachrichten für ein unseriöses Finanzprodukt zu werben scheint. Dabei hat er jedoch nie ein solches Video aufgenommen.

Die digitale Welt entwickelt sich ständig weiter und bringt neue Technologien und Dienste hervor, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Ein Beispiel ist Clearview AI, ein umstrittenes Unternehmen, das Gesichtserkennungstechnologien einsetzt. Damit steht es im Mittelpunkt einer Debatte über den angemessenen Einsatz solcher Technologien und den Schutz der Privatsphäre.

Der Trend hin zu nachhaltigen Produkten und umweltbewusstem Konsum hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Leider nutzen manche Unternehmen diese Entwicklung aus, um sich ein grünes Image zu geben, ohne tatsächlich nachhaltig zu handeln. Dieses Phänomen, bekannt als Greenwashing, kann Verbraucher täuschen und den Ruf von Unternehmen schädigen. Dem will nun die EU-Kommission mit einer neuen Richtlinie entgegentreten.
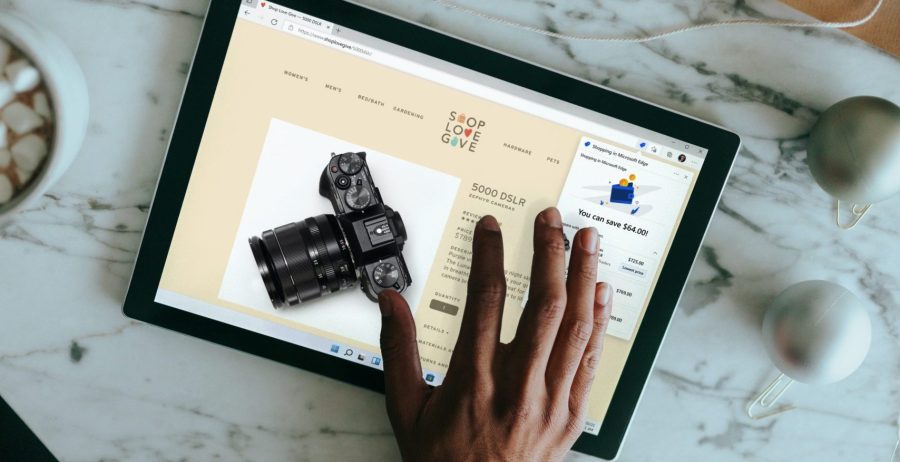
Nach wie vor sind noch nicht alle Rechtsfragen im Bereich des E-Commerce geklärt. Ein besonders kontrovers diskutiertes Thema betrifft die Gestaltung von Bestellbuttons und die damit verbundene Transparenz für Verbraucher. Vor kurzem hat das Landgericht Hildesheim in seiner Entscheidung präzisiert, wie die Gestaltung eines Bestellbuttons konkret auszusehen hat.

Das Internet der Dinge (IoT) hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt und wird immer mehr Teil unseres Alltags. Die Europäische Union hat reagiert und mit dem Data Act neue gesetzliche Regelungen geschaffen, um den Umgang mit Daten in diesen Bereichen zu regeln. Er zielt darauf ab, den Schutz personenbezogener Daten zu stärken und gleichzeitig den rechtmäßigen Umgang mit Daten zu fördern.

Im vergangenen Jahr erließ das LG München I ein Urteil, in welchem dem Betroffenen ein Schadensersatzanspruch wegen unrechtmäßiger Datenverarbeitung in Höhe von EUR 100,00 zugesprochen wurde. Die Folge waren massenweise Abmahnungen an Unternehmer. In einem anderen Urteil entschied das LG Oldenburg, dass dem Kläger ein Schadensersatz in Höhe von EUR 10.000,00 zusteht, weil der Beklagte seiner Auskunftserteilungspflicht zu spät nachgekommen ist. In beiden Fällen waren den Betroffenen keine konkreten Schäden entstanden. Nun entschied der EuGH, dass ein bloßer Verstoß gegen die DSGVO noch keinen Schadensersatzanspruch begründen kann. Es muss darüber hinaus ein Schaden nachgewiesen werden.

Der Kampf um die Überwachung der Online-Kommunikation geht in die nächste Runde! Die EU, Großbritannien und die USA wollen die Online-Kommunikation ihrer Bürger durchleuchten, um sie vor illegalen Inhalten zu schützen. Doch der geplante Einsatz des sogenannten Client-Side-Scannings zur Überprüfung der Nachrichteninhalte stößt auf heftige Kritik. Warum könnte das für die Nutzer gefährlich werden? Welche Ziele verfolgen die Regierungen mit dieser groß angelegten Überwachung? Was muss dabei in Hinblick auf die Grundrechte beachtet werden?

Musik macht Videos lebendiger und attraktiver – das wissen auch Unternehmen, die Instagram nutzen, um ihre Produkte zu präsentieren. Doch Vorsicht ist geboten: Wer ohne Erlaubnis des Rechteinhabers Musik in seinen Reels verwendet, verstößt gegen das Urheberrecht. Die Folge: Abmahnungen, Klagen und hohe Schadensersatzforderungen. Im folgenden werden daher die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet und Risiken aufgezeigt, die Unternehmen bei der Verwendung von Musik in Reels beachten sollten.
Seit Freitag ist ChatGPT in Italien nicht mehr zugänglich. Der Grund? Die italienische Datenschutzbehörde hat OpenAI verboten persönliche Daten italienischer Bürger zu verarbeiten. Daraufhin sperrte OpenAI den Zugang.
Verstoß gegen Daten- und Jugendschutzvorschriften.
Grund für das behördliche Vorgehen soll eine Datenpanne gewesen sein, bei der Nutzern Informationen fremder Profile angezeigt wurden. OpenAI verwies dabei auf einen Softwarefehler. Die Datenschutzbehörde warf OpenAI daraufhin unter anderem vor keine ausreichenden Maßnahmen für die Einhaltung des Jugendschutzes ergriffen zu haben. Es müsse gewährleistet sein, dass Jugendliche unter 13 Jahren keinen Zugang zu der KI erhalten, um sie so vor jugendfreien Informationen zu schützen. Darüber hinaus soll die Behörde auch erhebliche Bedenken bezüglich der unkontrollierten Datenverarbeitung durch ChatGPT haben. Weder die Behörden noch die Nutzer wissen, wie die eingegebenen Daten von der KI verarbeitet werden. Deshalb fordern die Behörden mehr Transparenz. Sollte OpenAI nicht innerhalb von 20 Tagen reagieren, so droht eine Geldbuße von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes.
Grundsätzlich ist ein entsprechendes Vorgehen auch in Deutschland möglich
– Sprecherin des Bundesdatenschutzbeauftragten in Deutschland.
Das Bundesdigitalministerium kritisiert hingegen das Vorgehen der italienischen Behörden:
Wir brauchen kein Verbot von KI-Anwendungen, sondern Wege, Werte wie Demokratie und Transparenz zu gewährleisten.

Nachdem ChatGPT Anfang dieses Jahres große Wellen geschlagen hatte, scheint die Begeisterung nun etwas abgeklungen zu sein. Das könne zum einen an der bisher hohen Fehlerquote insbesondere im Rahmen von rechtlichen Fragestellungen liegen. Zum anderen haben viele Nutzer aber auch Bedenken bezüglich der Risiken. Welche das sind und worauf man bei dem Einsatz von ChatGPT achten sollte, um mögliche Haftungsfälle zu vermeiden, wird im Folgenden erläutert.
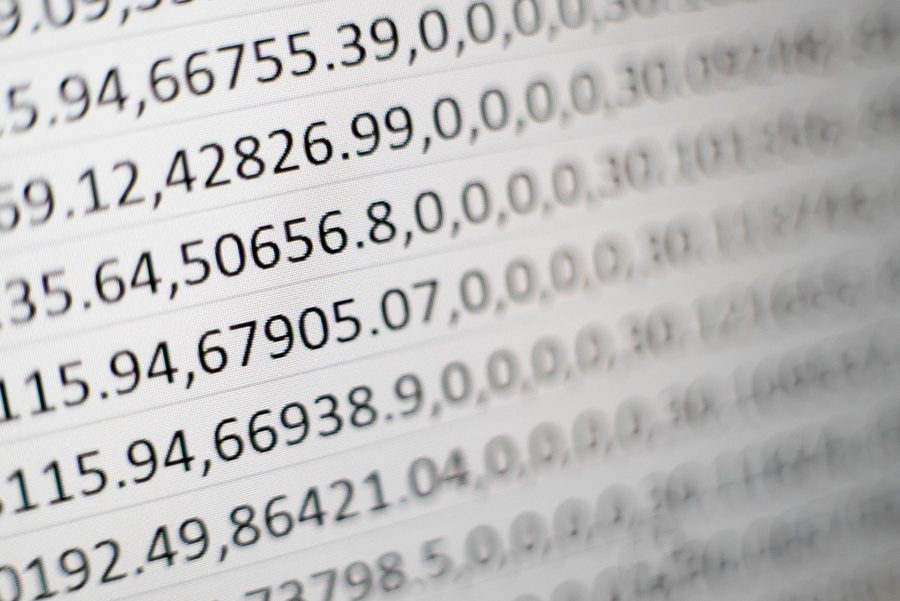
In einem aktuellen Urteil entschied das LG Leipzig zugunsten von Sony, dass die Zugangsverschaffung zu einer Domain mit urheberrechtsverletzenden Inhalten durch einen DNS-Resolver-Dienst eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Urheberrechts darstellt. Dieses Urteil stößt jedoch in den Fachkreisen bei vielen auf Unverständnis und Kritik.

Dieses Jahr war unter anderem geprägt von einer enormen Abmahnwelle wegen der datenschutzwidrigen Einbindung von Google Fonts. Wir hatten in mehreren Berichten bereits darauf hingewiesen, dass die Abmahnungen teilweise rechtsmissbräuchlich erfolgten. Nun scheint sich die Situation mittlerweile etwas beruhigt zu haben. Für einen Anwalt aus Berlin zieht die Abmahnpraxis jedoch rechtliche Konsequenzen nach sich. Ihm wird Abmahnbetrug und Erpressung vorgeworfen.

Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) ist auch im juristischen Bereich nicht aufzuhalten. Eine besonders vielversprechende Anwendung ist ChatGPT, ein großer Sprach- und Textgenerator, der von OpenAI entwickelt wurde. An der Universität von Minnesota, USA, hat die KI sogar schon das juristische Staatsexamen bestanden. Doch wie genau funktioniert ChatGPT und welche Herausforderungen gibt es bei der Anwendung in der Rechtswissenschaft? Wie kann ChatGPT genutzt werden, um die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten zu erleichtern? Und kann es sogar eigenständig rechtliche Probleme lösen?

Nachdem in den letzten Jahren bereits mehrfach Klagen wegen Datenschutzverstößen gegen Meta und ihre Tochtergesellschaften erhoben wurden, folgen nun erneute Vorwürfe. In einem Rechtsverfahren, in dem Meta den Datenhändler Bright Data wegen Datenschutzverstößen verklagte, fanden sich Hinweise auf eine ehemalige Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen.
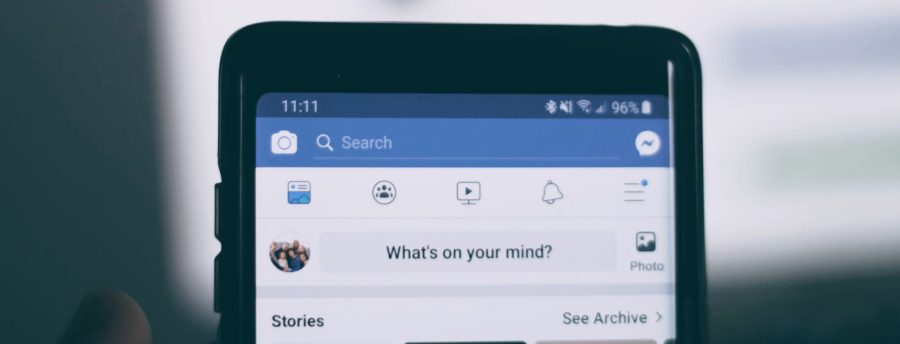
Mit Hatespeech ist jede Form von Äußerung gemeint, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von auf Intoleranz basierendem Hass rechtfertigt oder fördert. Die Fälle von Hatespeech steigen weiterhin rasant an. Die Anonymität des Internets scheint für die Täter eine Berechtigung darzustellen, Mitmenschen gegenüber ehrverletzende Äußerungen zu veröffentlichen. Dass dies erhebliche Folgen für das Opfer nach sich ziehen kann, ist wohl allgemein bekannt.
Aber welche Rechte hat das Opfer gegenüber dem Täter? Welche Pflichten treffen dabei die Plattformen? Und wie kann man sich dagegen wehren?
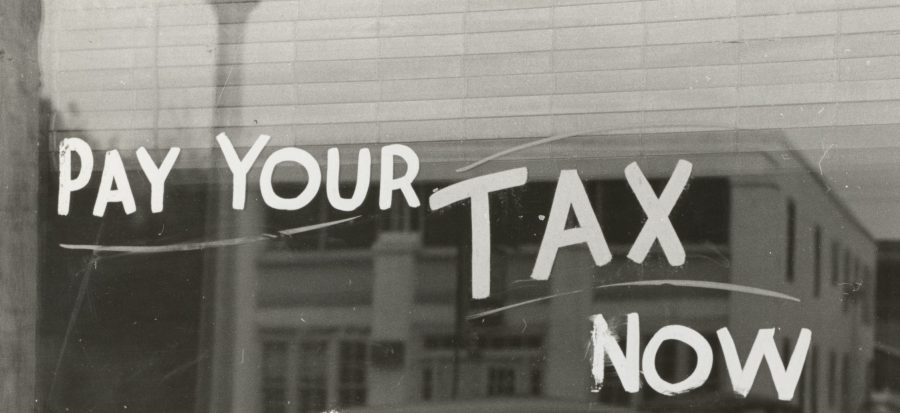
Plattformen für den An- und Verkauf von Waren oder Angebote von Dienstleistungen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen nutzen die Plattformen, um Einkünfte zu erzielen. Jedoch gehen die Finanzbehörden davon aus, dass viele dieser Einkünfte nicht oder nur unvollständig an das Finanzamt gemeldet werden. Dem soll das seit 01.01.2023 in Kraft getretene Plattform-Steuertransparenzgesetz (PStTG) entgegentreten. Künftig sind Plattformbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, Nutzerdaten von Verkäufern an das Finanzamt zu übermitteln. Durch die erhöhte Transparenz soll die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -betrug erleichtert werden.

Im Rahmen des Rechts auf Vergessenwerden müssen Suchmaschinen Inhalte entfernen, wenn nachgewiesen ist, dass diese offensichtlich unrichtig sind. Mit der Frage, welche Anforderungen an den Nachweis der Unrichtigkeit zu stellen sind, setzte sich nun der EuGH in einem aktuellen Urteil auseinander.

Vier Monate nach der gesetzlichen Einführung des Kündigungsbuttons (§ 312k BGB) scheinen immer noch viele Unternehmer den gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsbutton nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben. Nun prüft die Verbraucherzentrale verstärkt Internetseiten auf solche Mängel und mahnt diese ab.

Der EuGH entschied erst im September in einem Urteil, dass die im deutschen Recht vorgesehene anlasslose Vorratsdatenspeicherung gegen Unionsrecht verstößt. Die EU-Kommission plant hingegen schon seit längerem das sogenannte Chatkontrolle-Gesetz zu erlassen. Dieses soll Regelungen zur verdachtsunabhängigen, anlasslosen Überwachung digitaler Kommunikation enthalten. Wie soll das mit dem aktuellen Urteil des EuGH vereinbar sein? Und wie soll ein solches Gesetz in Deutschland überhaupt DSGVO-konform ausgestaltet werden?

Nach wie vor erhalten wir massenhaft Schreiben von Mandanten, die Abmahnungen wegen des Einsatzes von Google Fonts erhalten. Den Website-Betreibern wird ein unzulässiger Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgeworfen. Aber was kann man gegen eine solche Abmahnung tun? Nachstehend sollen Handlungsalternativen und ein denkbares Muster-Antwortschreiben aufgezeigt werden.

Heute bestätigte der EuGH in einem Urteil, dass die deutschen Regelungen der allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Dabei stellte der Gerichtshof auch Grenzen für Neuregelungen klar.

Nutzerbewertungen im Internet sind für Unternehmen extrem wichtig. So können sich negative Bewertungen schnell auf das gute Image von Unternehmen auswirken und so zu Umsatzeinbüßen führen. Die Frage welche Rechte dem Betroffenen dabei zustehen und welche Pflichten den Portalbetreiber treffen, haben wir bereits ausführlich in einem anderen Beitrag beantworten können.
Nun gibt es neue Entwicklungen: In einem aktuellen Urteil des BGH wurde entscheiden, dass Betroffene sich nun leichter gegen negative Bewertungen im Internet wehren können als bisher angenommen. Dafür soll lediglich das Bestreiten des Kundenkontakts ausreichen. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Identität des Kunden aus der Bewertung ohne Weiteres ersichtlich ist.

Nachdem der Meme-Paragraf nun schon seit etwas über einem Jahr in Kraft ist, soll ein kleines Résumé gezogen werden bezüglich der Frage: Ist tatsächlich jedes Meme auch eine Parodie? Und darf alleine deshalb ein urheberrechtlich geschütztes Bild einfach so verwendet werden?
Memes haben in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen und sind nun aus unserer alltäglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Ob politisch, gesellschaftskritisch oder einfach nur lustig, spielt dabei meist gar keine so große Rolle. Ein passendes Meme findet sich zu allen Lebenslagen.

In einem aktuellen Urteil des Amtsgerichts München wurde ein Mann wegen Hassrede schuldig gesprochen. Nun muss er ein Jahr in Haft verbringen. Der Angeklagte beschimpfte die in Kusel, Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten als „Bastarde“ und brüllte den Münchner Polizisten entgegen sie gehören genauso erschossen.

Die korrekte Angabe des Grundpreises bereitet Online-Shops immer noch Schwierigkeiten. Fehlende oder fehlerhafte Grundpreisangaben sind deshalb ein Dauerbrenner bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen. In einem aktuellen Urteil stellte der BGH (Urteil vom 19.05.2022, Az.: I ZR 69/21) nun klar, dass der Warenpreis und der Grundpreis auf einen Blick wahrgenommen werden müssen. Somit ist klar: eine Angabe des Grundpreises beispielsweise in der Artikelbeschreibung reicht nicht mehr aus.

Früher waren Plattformen im Rahmen von Urheberrechtsverletzungen nur zur Unterlassung verpflichtet. In einem aktuellen Urteil stellte der BGH nun klar, dass Internetplattformen künftig unter bestimmten Bedingungen für Urheberrechtsverstöße von Nutzern auch selbst zu Schadensersatz und Auskunft über die Identität des Nutzers verpflichtet werden können.

Die Rechtslage wird für Online-Händler und Plattformen durch eine neue Änderung des Verpackungsgesetzes weiter verschärft. Ab dem 01.07.2022 gilt: Händler die nicht bei der Datenbank LUCID registriert sind, werden ihre Waren nicht mehr auf elektronischen Marktplätzen verkaufen dürfen. Ob ein Händler registriert ist, werden die Plattformen selbst überprüfen müssen. Dadurch soll die Beteiligung an Entsorgungskosten sichergestellt werden.

Am 23.04.2022 einigten sich das Europäische Parlament und die Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Fassung des Digital Service Act (DSA). Fortan soll nun im gesamten EU-Raum das Prinzip gelten: Was bereits offline illegal ist, soll auch online illegal sein. Ziel ist also die stärkere Regulierung des Internets, damit weniger Hass, Hetze und Desinformation verbreitet werden. Dies soll insbesondere durch strengere Auflagen für Tech-Giganten garantiert werden.
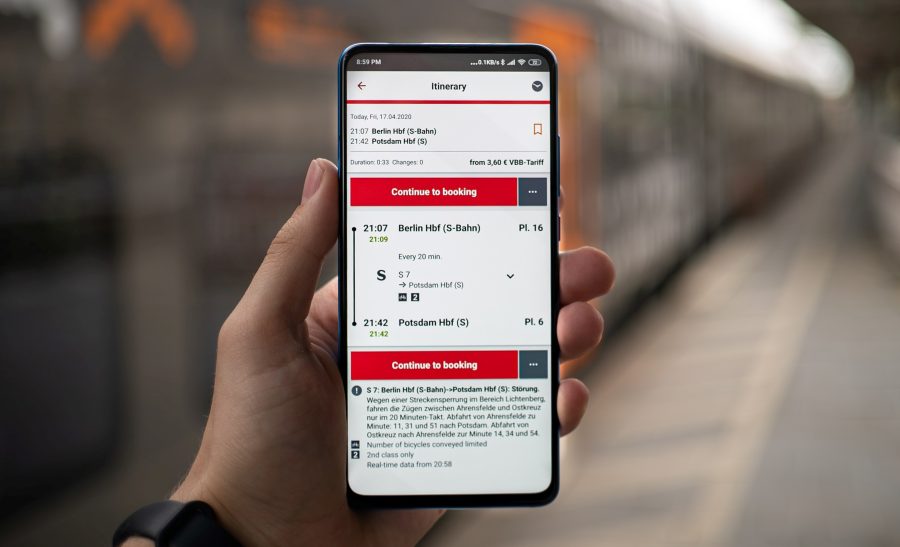
Bisher bestanden große Unsicherheiten bei Onlinehändlern, wenn es um die Frage ging, ob der Bestellbutton auf einer Online-Seite mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ gekennzeichnet sein muss. Viele befürchteten, dass bei einer alternativen Beschriftung keine wirksamer Vertrag mit dem Kunden zustande kommen würde. Deshalb trauten sie sich nicht, von diesem Wortlaut abzuweichen. In einem aktuellen Urteil hat der EuGH diese Unsicherheiten nun beseitigt. Nun steht fest, dass nicht unbedingt die Angabe „zahlungspflichtig bestellen“ auf der Schaltfläche stehen muss. Andere Formulierungen sind auch zulässig, solange diese eindeutig und unmissverständlich sind.

Mit den beschlossenen Neuregelungen sorgen wir zudem für deutlich mehr Rechtssicherheit und Transparenz im digitalen Geschäftsverkehr. Für Online-Marktplätze führen wir umfassende Hinweis- und Transparenzpflichten ein. Betreiber von Online-Marktplätzen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft darüber aufklären, warum bestimmte Produkte ganz oben im Produkt-Ranking angezeigt werden, und ob ihr Vertragspartner Unternehmer oder selbst Verbraucher ist. Anbieter müssen klar und deutlich darauf hinweisen, wenn ein Preis personalisiert – also auf einen bestimmten Kunden zugeschnitten – berechnet wurde.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht

Das OLG Karlsruhe hat jüngst in einem Urteil festgestellt, dass die Beschränkung der Anreden auf „Frau“ oder „Herr“ in Online-Shops diskriminierend ist. Personen nicht binären Geschlechts werden dadurch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) benachteiligt und in ihrem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt.

Darf Facebook aufgrund der eigenen AGB bzw. Gemeinschaftsstandards Posts von Nutzern einfach löschen? Dürfen auf dieser Grundlage Nutzerkonten deaktiviert oder Nutzer gesperrt werden? Diese Fragen wurden im Jahr 2021 erstmals vom BGH beantwortet. In einem aktuellen Urteil wendet das OLG Karlsruhe die Rechtsprechung des BGH an. Spoiler: Facebook darf sich die Sperrung von Accounts und Entfernung von Beiträgen nach eigenem Ermessen nicht vorbehalten.