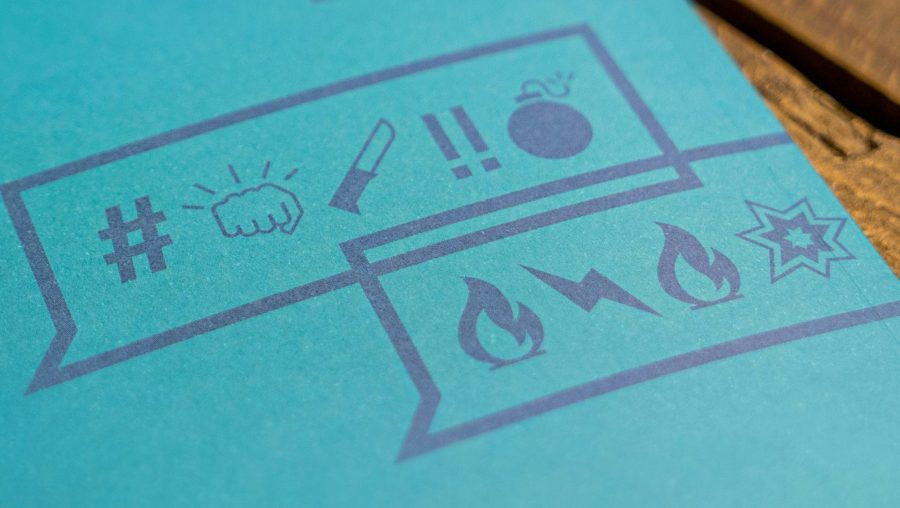Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) revolutioniert zahlreiche Branchen und birgt gleichzeitig rechtliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Urheberrecht. Früher waren normale Nutzer häufig Zielscheibe von Abmahnungen und Klagen wegen banaler Urheberrechtsverletzungen. Heute scheinen sich finanzkräftige Unternehmen frei für ihr KI-Training zu bedienen, ohne die Rechte der Urheber zu beachten. Dies wirft die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, KI-Modelle ohne Verletzung des Urheberrechts zu entwickeln.
Kategorie: Uncategorized Seite 1 von 3
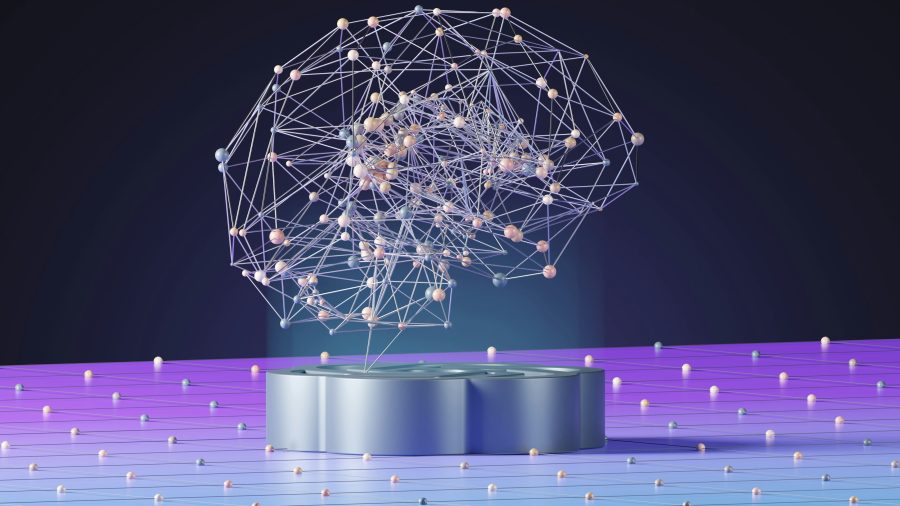
Letzte Woche stimmten die Abgeordneten des EU-Parlaments mehrheitlich für eine neue Regelung: das weltweit erste KI-Gesetz. Demnach sollen künftig KI-gesteuerte Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt und entsprechend reguliert werden. Können wir uns nun beim Umgang mit KI entspannt zurück lehnen?
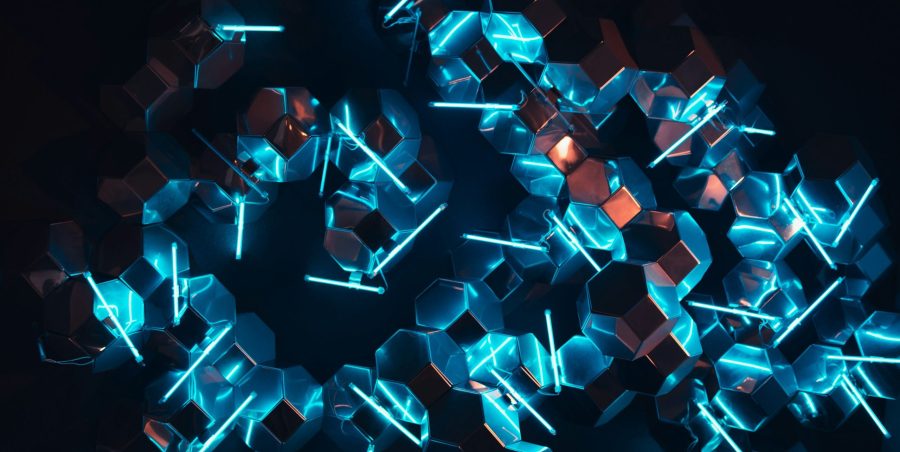
Der EuGH beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren immer wieder mit der Frage unter welchen Voraussetzungen ein immaterieller Schadensersatz bei Datenschutzverstößen zulässig sein soll. Letztes Jahr erteilte er in zwei wegweisenden Urteilen zunächst der Erheblichkeitsschwelle eine Absage und ließ später bereits die Befürchtung eines Datenmissbrauchs für einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz ausreichen. In seinem aktuellen Urteil bestätigt der Gerichtshof seine vorangegangenen Entscheidungen und engt die Anforderungen ein, indem er einen Anspruch aufgrund eines rein hypothetisches Risikos ablehnt.

Im Frühling diesen Jahres läuft neben der Frist für die nationale Umsetzung des DSA auch die einer weiteren bedeutenden EU-Verordnung aus. Bis zum 06.03.2024 müssen Gatekeeper ihre Pflichten aus dem Digital Market Act (DMA) umgesetzt haben. Dieses Wettbewerbsgesetz stellt sicher, dass einzelne Unternehmen nicht durch die „Torwächter“ behindert werden. Google informierte seine Nutzer bereits über zukünftige Änderungen.

In knapp einem Monat, am 17. Februar, tritt der Digital Services Act allumfänglich in Kraft. Bisher waren nur sehr große Plattformen und Suchmaschinen von der EU-Verordnung betroffen. Jedoch hagelt es seit dem Inkrafttreten im November 2022 Kritik. So soll bisher nicht nur die Beachtung der Rechtspflichten durch die großen Unternehmen sehr spärlich sein, sondern auch die Einhaltung der Umsetzungsfrist bis Februar 2024 in einigen EU-Mitgliedstaaten wohl nicht möglich sein.

In einer Welt, in der künstliche Intelligenz immer mehr in den Alltag integriert wird, stellen visuell generative KI-Modelle wie Midjourney und Dall-E 3 nicht nur technologische Durchbrüche dar, sondern werfen auch ernsthafte rechtliche Bedenken auf. Besonders in Bezug auf die nahezu unveränderte Reproduktion von Szenen aus Filmen und Serien könnten solche Technologien Nutzern erhebliche juristische Probleme bescheren.

In einem aktuellen Urteil stärkte der EuGH die Rechte des Verbrauchers für den Fall eines Hackerangriffs. Künftig soll bereits die Befürchtung eines Datenmissbrauchs für die Geltendmachung von immateriellem Schadensersatz bei einer Verletzung der Rechte aus der DSGVO ausreichen. Außerdem werden Unternehmen die gehackt wurden, in der Regel nicht mehr vorbringen können, schuldlos an einem Hack ihrer Systeme zu sein.

Das Internet hat das Einkaufsverhalten revolutioniert, indem es uns ermöglicht Produkte und Dienstleistungen anhand von Bewertungen anderer Verbraucher zu bewerten. Sternebewertungen sind zu einem entscheidenden Element geworden, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Doch wie transparent müssen Unternehmen bei der Verwendung solcher Bewertungen sein?

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung zweier Verbraucherkanzleien hat aufgedeckt, dass beinahe alle deutschen Mobilfunkanbieter über Jahre hinweg Kundendaten ohne Zustimmung der Kunden an die Schufa weitergeleitet haben. Dies hat nun eine mögliche Klagewelle gegen die Telefongesellschaften ausgelöst. Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass unrechtmäßig Handydaten von Millionen von Verbrauchern gespeichert wurden.
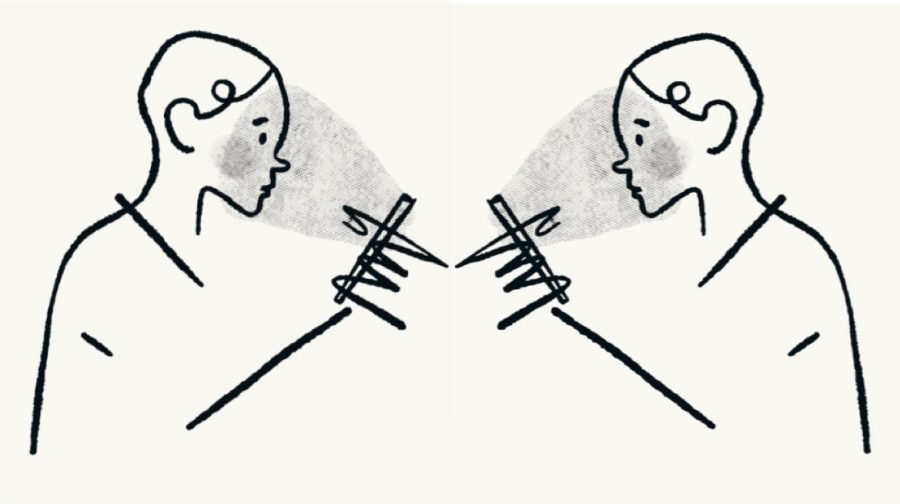
Und weiter geht es in der Welt der neuen Technologien: Nachdem sich unser letzter Beitrag mit Gesichtserkennungstechnologien befasst hat, folgen nun News zu Deepfakes. Bei Deepfakes geht es um die Erstellung von Klonen mittels künstlicher Intelligenz. Doch wer nun bei Klonen gleich an das Schaf Dolly denkt, täuscht sich. Vielmehr geht es um die Fälschung und Erstellung von Identitäten in Videos, Tonaufnahmen oder Texten. Derzeit kursiert in den deutschen Medien ein Video des Nachrichtensprechers Christian Sievers, indem der Sprecher in den Heute-Nachrichten für ein unseriöses Finanzprodukt zu werben scheint. Dabei hat er jedoch nie ein solches Video aufgenommen.

Die digitale Welt entwickelt sich ständig weiter und bringt neue Technologien und Dienste hervor, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Ein Beispiel ist Clearview AI, ein umstrittenes Unternehmen, das Gesichtserkennungstechnologien einsetzt. Damit steht es im Mittelpunkt einer Debatte über den angemessenen Einsatz solcher Technologien und den Schutz der Privatsphäre.

Ab dem 01.07.2023 begleiten wir Sie unter eine neuen Kanzleibezeichnung und in neuen Räumen. Die Zusammenarbeit mit Ihnen setzen wir wie gewohnt fort.
FX legal
Christos Paloubis
Rechtsanwalt
Felix Gebhard
Rechtsanwalt und zertifizierter Datenschutzbeauftragter (DSB-TÜV SÜD)
Widenmayerstraße 4
D – 80538 München
Tel . +49 89 21 11 22 90
Fax +49 89 21 11 22 91
Weiter Infos folgen in Kürze …
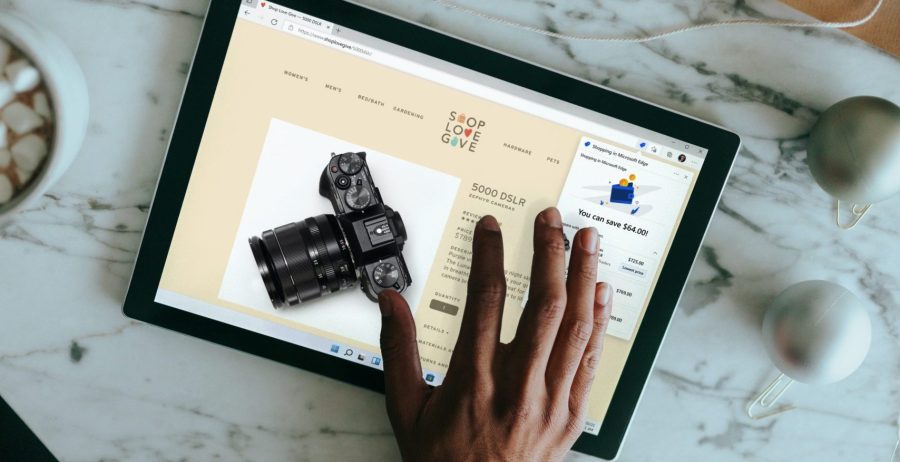
Nach wie vor sind noch nicht alle Rechtsfragen im Bereich des E-Commerce geklärt. Ein besonders kontrovers diskutiertes Thema betrifft die Gestaltung von Bestellbuttons und die damit verbundene Transparenz für Verbraucher. Vor kurzem hat das Landgericht Hildesheim in seiner Entscheidung präzisiert, wie die Gestaltung eines Bestellbuttons konkret auszusehen hat.

Das Internet der Dinge (IoT) hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt und wird immer mehr Teil unseres Alltags. Die Europäische Union hat reagiert und mit dem Data Act neue gesetzliche Regelungen geschaffen, um den Umgang mit Daten in diesen Bereichen zu regeln. Er zielt darauf ab, den Schutz personenbezogener Daten zu stärken und gleichzeitig den rechtmäßigen Umgang mit Daten zu fördern.

Im vergangenen Jahr erließ das LG München I ein Urteil, in welchem dem Betroffenen ein Schadensersatzanspruch wegen unrechtmäßiger Datenverarbeitung in Höhe von EUR 100,00 zugesprochen wurde. Die Folge waren massenweise Abmahnungen an Unternehmer. In einem anderen Urteil entschied das LG Oldenburg, dass dem Kläger ein Schadensersatz in Höhe von EUR 10.000,00 zusteht, weil der Beklagte seiner Auskunftserteilungspflicht zu spät nachgekommen ist. In beiden Fällen waren den Betroffenen keine konkreten Schäden entstanden. Nun entschied der EuGH, dass ein bloßer Verstoß gegen die DSGVO noch keinen Schadensersatzanspruch begründen kann. Es muss darüber hinaus ein Schaden nachgewiesen werden.

Musik macht Videos lebendiger und attraktiver – das wissen auch Unternehmen, die Instagram nutzen, um ihre Produkte zu präsentieren. Doch Vorsicht ist geboten: Wer ohne Erlaubnis des Rechteinhabers Musik in seinen Reels verwendet, verstößt gegen das Urheberrecht. Die Folge: Abmahnungen, Klagen und hohe Schadensersatzforderungen. Im folgenden werden daher die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet und Risiken aufgezeigt, die Unternehmen bei der Verwendung von Musik in Reels beachten sollten.
Seit Freitag ist ChatGPT in Italien nicht mehr zugänglich. Der Grund? Die italienische Datenschutzbehörde hat OpenAI verboten persönliche Daten italienischer Bürger zu verarbeiten. Daraufhin sperrte OpenAI den Zugang.
Verstoß gegen Daten- und Jugendschutzvorschriften.
Grund für das behördliche Vorgehen soll eine Datenpanne gewesen sein, bei der Nutzern Informationen fremder Profile angezeigt wurden. OpenAI verwies dabei auf einen Softwarefehler. Die Datenschutzbehörde warf OpenAI daraufhin unter anderem vor keine ausreichenden Maßnahmen für die Einhaltung des Jugendschutzes ergriffen zu haben. Es müsse gewährleistet sein, dass Jugendliche unter 13 Jahren keinen Zugang zu der KI erhalten, um sie so vor jugendfreien Informationen zu schützen. Darüber hinaus soll die Behörde auch erhebliche Bedenken bezüglich der unkontrollierten Datenverarbeitung durch ChatGPT haben. Weder die Behörden noch die Nutzer wissen, wie die eingegebenen Daten von der KI verarbeitet werden. Deshalb fordern die Behörden mehr Transparenz. Sollte OpenAI nicht innerhalb von 20 Tagen reagieren, so droht eine Geldbuße von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes.
Grundsätzlich ist ein entsprechendes Vorgehen auch in Deutschland möglich
– Sprecherin des Bundesdatenschutzbeauftragten in Deutschland.
Das Bundesdigitalministerium kritisiert hingegen das Vorgehen der italienischen Behörden:
Wir brauchen kein Verbot von KI-Anwendungen, sondern Wege, Werte wie Demokratie und Transparenz zu gewährleisten.

Nachdem ChatGPT Anfang dieses Jahres große Wellen geschlagen hatte, scheint die Begeisterung nun etwas abgeklungen zu sein. Das könne zum einen an der bisher hohen Fehlerquote insbesondere im Rahmen von rechtlichen Fragestellungen liegen. Zum anderen haben viele Nutzer aber auch Bedenken bezüglich der Risiken. Welche das sind und worauf man bei dem Einsatz von ChatGPT achten sollte, um mögliche Haftungsfälle zu vermeiden, wird im Folgenden erläutert.
Der BGH (Urteil vom 25.03.2021, Az.: I ZR 203/19) hat entschieden, dass die Bezahlmethoden PayPal und Sofortüberweisung nicht in den Anwendungsbereich des § 270a BGB fallen. Daher können Unternehmen von ihren Kunden zusätzliche Gebühren für die Nutzung von PayPal und Sofortüberweisung verlangen.

Das neue Social Media Verbot in Utah für Minderjährige. Blue Print zum Schutz der Jugend?
In Utah wurde kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das es Minderjährigen unter 18 Jahren verbietet, soziale Medien wie Facebook, Instagram und Snapchat zu nutzen. Dieses Gesetz, das am 1. April 2023 in Kraft tritt, sieht Geldstrafen für Minderjährige und ihre Eltern vor, wenn sie gegen das Verbot verstoßen.
Die Befürworter des Gesetzes argumentieren, dass es notwendig ist, um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Internet zu gewährleisten. Sie weisen darauf hin, dass soziale Medien Plattformen für Mobbing, sexuelle Belästigung und andere Formen von Gewalt bieten können. Durch das Verbot sollen Minderjährige vor diesen Risiken geschützt werden.
Kritiker des Gesetzes sagen jedoch, dass es die Freiheit der Meinungsäußerung von Minderjährigen einschränkt und ihre Fähigkeit beeinträchtigt, sich mit Freunden und Gleichaltrigen zu vernetzen. Sie argumentieren, dass es bessere Wege gibt, um Kinder und Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien zu schulen und zu schützen, ohne ihre Freiheiten zu beschränken.
Einige Experten haben auch Bedenken geäußert, dass das Gesetz möglicherweise schwer durchzusetzen sein könnte. Es ist schwer vorstellbar, wie die Behörden die Aktivitäten von Millionen von Minderjährigen auf sozialen Medien kontrollieren könnten.
Das neue Gesetz in Utah verbietet Minderjährigen unter 18 Jahren die Nutzung von sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Snapchat und Instagram. Es sieht Geldstrafen für Minderjährige und ihre Eltern vor, wenn sie gegen das Verbot verstoßen. Eine erste Verletzung des Gesetzes wird mit einer Geldstrafe von 10 US-Dollar geahndet, bei wiederholten Verstößen können die Strafen jedoch auf bis zu 500 US-Dollar ansteigen.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen von diesem Verbot. Minderjährige können soziale Medien nutzen, wenn sie von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden oder wenn sie die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten haben. Außerdem können sie soziale Medien nutzen, um auf Bildungs- und berufliche Angelegenheiten zuzugreifen, beispielsweise für Schulprojekte oder für die Suche nach Arbeitsplätzen.
Das Gesetz betrifft auch nicht alle Arten von sozialen Medien. Minderjährige können weiterhin Plattformen wie LinkedIn, Skype, Zoom und E-Mail nutzen. Das Gesetz richtet sich hauptsächlich an Social-Media-Plattformen, die für die Kommunikation zwischen Gleichaltrigen genutzt werden und bei denen die Nutzer in der Regel weniger Kontrolle über die Inhalte haben.
Obwohl das Gesetz darauf abzielt, Minderjährige vor Risiken wie Mobbing, sexueller Belästigung und anderen Formen von Gewalt im Internet zu schützen, gibt es Bedenken, dass es die Meinungsfreiheit und die Fähigkeit von Minderjährigen, sich mit Freunden und Gleichaltrigen zu vernetzen, einschränken könnte. Einige Experten haben auch Bedenken geäußert, dass es schwierig sein wird, das Verbot durchzusetzen, insbesondere da Minderjährige möglicherweise Wege finden werden, es zu umgehen.
Insgesamt wird das Verbot der Nutzung von sozialen Medien für Minderjährige in Utah sicherlich weiterhin Diskussionen und Debatten auslösen. Es bleibt abzuwarten, ob andere Staaten in den USA oder sogar andere Länder ähnliche Gesetze einführen werden.
In jedem Fall zeigt die Verabschiedung dieses Gesetzes die wachsenden Bedenken bezüglich der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Internet. Es wird interessant sein zu sehen, ob andere Staaten in den USA oder sogar andere Länder dem Beispiel von Utah folgen werden. In der Zwischenzeit sollten Eltern und Erziehungsberechtigte sich über die Risiken sozialer Medien im Klaren sein und mit ihren Kindern über verantwortungsvolle und sichere Nutzung sprechen.
Der BGH beschäftigte sich mit verschiedenen Fragen rund um das sogenannte Abschlussschreiben. Für juristische Laien wird dieser Begriff weitestgehend unverständlich sein. In seinem Urteil klärte der BGH jedoch einige Detailfragen der täglichen Praxis für Anwälte im Wettbewerbsrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Eher beiläufig äußerte er sich dabei auch zum Zeitpunkt des Beginns der Überlegungsfrist, die dem Gegner gewährt werden muss – und kam dabei zum gegenteiligen Ergebnis wie nahezu zeitgleich das LG München I (Urteil vom 25.02.2015 – 37 O 16512/14).
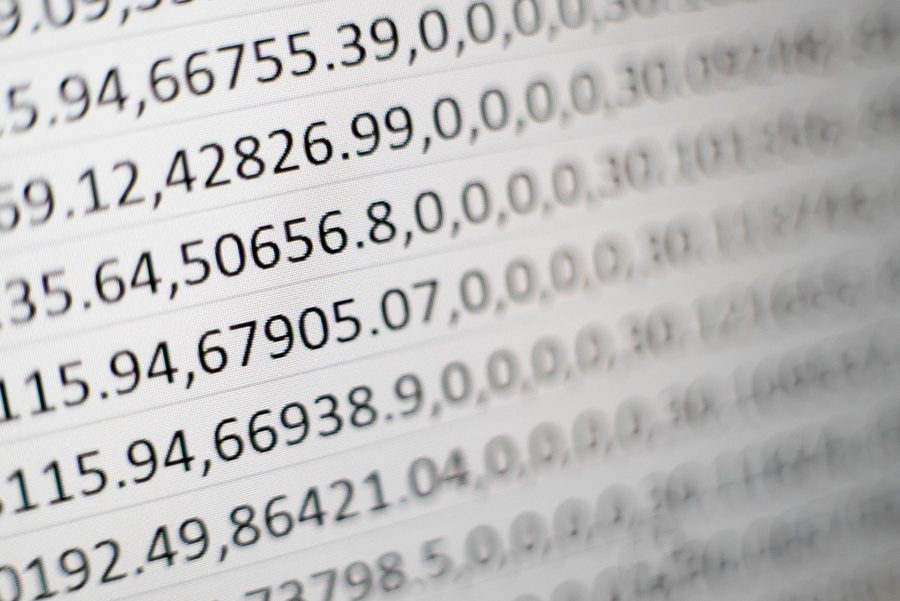
In einem aktuellen Urteil entschied das LG Leipzig zugunsten von Sony, dass die Zugangsverschaffung zu einer Domain mit urheberrechtsverletzenden Inhalten durch einen DNS-Resolver-Dienst eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Urheberrechts darstellt. Dieses Urteil stößt jedoch in den Fachkreisen bei vielen auf Unverständnis und Kritik.

Dieses Jahr war unter anderem geprägt von einer enormen Abmahnwelle wegen der datenschutzwidrigen Einbindung von Google Fonts. Wir hatten in mehreren Berichten bereits darauf hingewiesen, dass die Abmahnungen teilweise rechtsmissbräuchlich erfolgten. Nun scheint sich die Situation mittlerweile etwas beruhigt zu haben. Für einen Anwalt aus Berlin zieht die Abmahnpraxis jedoch rechtliche Konsequenzen nach sich. Ihm wird Abmahnbetrug und Erpressung vorgeworfen.

Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) ist auch im juristischen Bereich nicht aufzuhalten. Eine besonders vielversprechende Anwendung ist ChatGPT, ein großer Sprach- und Textgenerator, der von OpenAI entwickelt wurde. An der Universität von Minnesota, USA, hat die KI sogar schon das juristische Staatsexamen bestanden. Doch wie genau funktioniert ChatGPT und welche Herausforderungen gibt es bei der Anwendung in der Rechtswissenschaft? Wie kann ChatGPT genutzt werden, um die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten zu erleichtern? Und kann es sogar eigenständig rechtliche Probleme lösen?

Nachdem in den letzten Jahren bereits mehrfach Klagen wegen Datenschutzverstößen gegen Meta und ihre Tochtergesellschaften erhoben wurden, folgen nun erneute Vorwürfe. In einem Rechtsverfahren, in dem Meta den Datenhändler Bright Data wegen Datenschutzverstößen verklagte, fanden sich Hinweise auf eine ehemalige Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen.
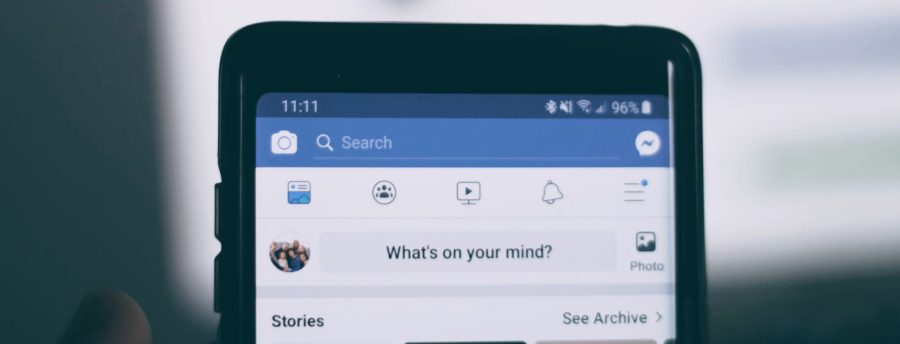
Mit Hatespeech ist jede Form von Äußerung gemeint, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von auf Intoleranz basierendem Hass rechtfertigt oder fördert. Die Fälle von Hatespeech steigen weiterhin rasant an. Die Anonymität des Internets scheint für die Täter eine Berechtigung darzustellen, Mitmenschen gegenüber ehrverletzende Äußerungen zu veröffentlichen. Dass dies erhebliche Folgen für das Opfer nach sich ziehen kann, ist wohl allgemein bekannt.
Aber welche Rechte hat das Opfer gegenüber dem Täter? Welche Pflichten treffen dabei die Plattformen? Und wie kann man sich dagegen wehren?
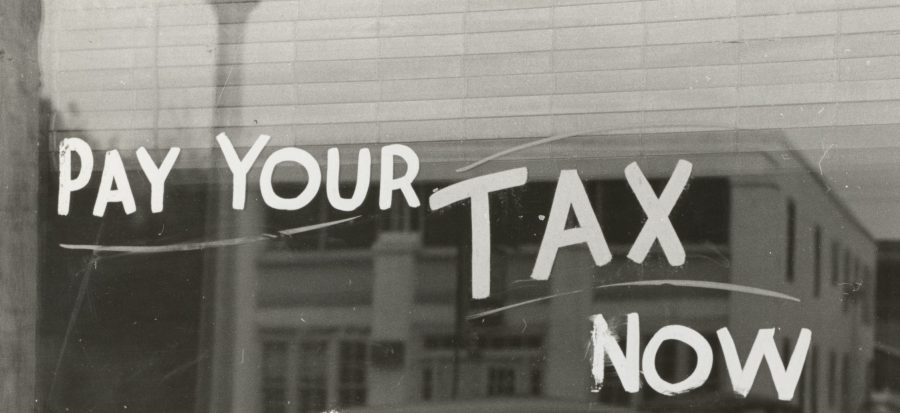
Plattformen für den An- und Verkauf von Waren oder Angebote von Dienstleistungen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen nutzen die Plattformen, um Einkünfte zu erzielen. Jedoch gehen die Finanzbehörden davon aus, dass viele dieser Einkünfte nicht oder nur unvollständig an das Finanzamt gemeldet werden. Dem soll das seit 01.01.2023 in Kraft getretene Plattform-Steuertransparenzgesetz (PStTG) entgegentreten. Künftig sind Plattformbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, Nutzerdaten von Verkäufern an das Finanzamt zu übermitteln. Durch die erhöhte Transparenz soll die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -betrug erleichtert werden.

Vier Monate nach der gesetzlichen Einführung des Kündigungsbuttons (§ 312k BGB) scheinen immer noch viele Unternehmer den gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsbutton nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben. Nun prüft die Verbraucherzentrale verstärkt Internetseiten auf solche Mängel und mahnt diese ab.

Der EuGH entschied erst im September in einem Urteil, dass die im deutschen Recht vorgesehene anlasslose Vorratsdatenspeicherung gegen Unionsrecht verstößt. Die EU-Kommission plant hingegen schon seit längerem das sogenannte Chatkontrolle-Gesetz zu erlassen. Dieses soll Regelungen zur verdachtsunabhängigen, anlasslosen Überwachung digitaler Kommunikation enthalten. Wie soll das mit dem aktuellen Urteil des EuGH vereinbar sein? Und wie soll ein solches Gesetz in Deutschland überhaupt DSGVO-konform ausgestaltet werden?

Nutzerbewertungen im Internet sind für Unternehmen extrem wichtig. So können sich negative Bewertungen schnell auf das gute Image von Unternehmen auswirken und so zu Umsatzeinbüßen führen. Die Frage welche Rechte dem Betroffenen dabei zustehen und welche Pflichten den Portalbetreiber treffen, haben wir bereits ausführlich in einem anderen Beitrag beantworten können.
Nun gibt es neue Entwicklungen: In einem aktuellen Urteil des BGH wurde entscheiden, dass Betroffene sich nun leichter gegen negative Bewertungen im Internet wehren können als bisher angenommen. Dafür soll lediglich das Bestreiten des Kundenkontakts ausreichen. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Identität des Kunden aus der Bewertung ohne Weiteres ersichtlich ist.

Nachdem der Meme-Paragraf nun schon seit etwas über einem Jahr in Kraft ist, soll ein kleines Résumé gezogen werden bezüglich der Frage: Ist tatsächlich jedes Meme auch eine Parodie? Und darf alleine deshalb ein urheberrechtlich geschütztes Bild einfach so verwendet werden?
Memes haben in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen und sind nun aus unserer alltäglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Ob politisch, gesellschaftskritisch oder einfach nur lustig, spielt dabei meist gar keine so große Rolle. Ein passendes Meme findet sich zu allen Lebenslagen.

Seit Monaten klären wir unsere Kunden und unsere Leser über die Gefahr bei der Verwendung von Google Fonts auf. Anlass ist ein Urteil des LG München I, wonach die unzulässige Einbindung von Google Fonts Schadenersatzansprüche von EUR 100,00 auslösen kann. Seit Wochen warnen wir, dass findige bzw „geschäftstüchtige“ Goldgräber bereits das passende Geschäftsmodell gewittert haben und Unternehmen mit Schadenersatzforderungen überziehen.

In einem aktuellen Urteil des Amtsgerichts München wurde ein Mann wegen Hassrede schuldig gesprochen. Nun muss er ein Jahr in Haft verbringen. Der Angeklagte beschimpfte die in Kusel, Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten als „Bastarde“ und brüllte den Münchner Polizisten entgegen sie gehören genauso erschossen.

Die Rechtslage wird für Online-Händler und Plattformen durch eine neue Änderung des Verpackungsgesetzes weiter verschärft. Ab dem 01.07.2022 gilt: Händler die nicht bei der Datenbank LUCID registriert sind, werden ihre Waren nicht mehr auf elektronischen Marktplätzen verkaufen dürfen. Ob ein Händler registriert ist, werden die Plattformen selbst überprüfen müssen. Dadurch soll die Beteiligung an Entsorgungskosten sichergestellt werden.

Nachdem die große Koalition die fristgerechte Umsetzung der sogenannten Whistleblower Richtlinie (EU 2019/1937) in nationales Recht versäumt hatte, könnte dies bald durch die Ampelkoalition erfolgen. Dies sieht zumindest der Koalitionsvertrag vor. Gegenstand der Whistleblower Richtlinie und mögliche Auswirkungen der Umsetzung auf Unternehmen haben sollen nachfolgend beleuchtet werden.

Leseempfehlung:
Ein Beitrag meines Kollegen Felix Gebhard zu den verschärften Regeln für Nudging bei Consent Tools!
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.datenschutzerklaerung.info zu laden.
OLG Brandenburg weist Abmahnung gegen unerwünschtes Zusenden von Werbung als rechtsmissbräuchlich ab
In einem Berufungsverfahren gegen eine Entscheidung des LG Frankfurt (Oder) hat das OLG Brandenburg eine auf einer Abmahnung basierende Klage für rechtsmissbräuchlich und somit für unzulässig erklärt. Das Gericht erarbeitete mehrere Indizien, um zu bewerten, inwieweit die Klägerin sachfremde Interessen verfolge und so womöglich ihre prozessualen Befugnisse missbrauche. Die hierbei herangezogenen Indizien könnten sich möglicherweise in der künftigen Rechtsprechung zum Thema rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen niederschlagen. Es lohnt sich daher eine genauere Betrachtung des Urteils.
Lange Jahre war jurablogs.de eine meiner bevorzugten Informationsquellen zu aktuellen Urteilen und Entwicklungen der Gesetzgebung. Mein Blog war selbst auch Teil des Angebots und nicht wenig Traffic habe ich hierüber bekommen.
Nach der Einstellung von jurablogs.de im vergangenen Jahr hat sich relativ schnell Daniel Bader mit seiner factuno UG angeboten, das Angebot und Konzept von jurablogs unter jurablo.gs fortzusetzen. Wir haben uns deshalb heute bei jurablo.gs angemeldet und freuen uns wieder Teil Jura-Blog-Community zu sein.
(Der folgende Gastbeitrag wurde von unserer Praktikantin Marie-Sophie Kosok verfasst, welche ab Oktober Rechtswissenschaften studieren möchte.)
Ein israelisches Gericht hat eine Frau zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 2.000,00 Euro verurteilt. Ein Vermieter hatte aufgrund ihrer Textnachricht samt interesseweckenden Emojis die Erwartung, dass bereits ein Mietvertrag besteht. Nachdem er seine Wohnungsannonce bereits gelöscht hatte, erteilte ihm die Frau jedoch eine Absage. Daraufhin verklagte er sie und gewann den Rechtsstreit. Wenn Missverständnisse bei Emojis entstehen, könnte es in auch Deutschland durch das Einsetzen der Culpa in Contrahendo (lat. = Verschulden bei Vertragsschluss) zu ähnlichen Folgen kommen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir aktuell:
- Studentische Hilfskräfte (m/w) / PraktikantInnen (auch für Pflichtpraktika)
- Referendare /-innen (auch Pflichtstation / Pflichtwahlpraktikum)
Sie überzeugen durch Ihr sympathisches sicheres Auftreten. Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich. Sie haben Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und sind an den neuen Medien und den damit zusammenhängenden Rechtsfragen interessiert.
Wir bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen, dynamischen Team und Kanzleiräume in attraktiver Innenstadtlage. Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Umfeld spannender, hochaktueller Fragestellungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email an info@bpm-legal.de.
Wegen Arbeiten an den Stromleitungen im Gebäude wird die Stromversorgung im Büro von BPM legal heute (08.06.2017) ab 14.30 Uhr unterbrochen.
Von der Unterbrechung wird auch unsere Telefonanlage betroffen sein. Deswegen können wir für den Rest des Tages (wohl) keine Telefonanrufe mehr empfangen. Da von der Unterbrechung auch unser Server und unsere Rechner betroffen sind, haben wir uns entschlossen, das Büro heute ab 14.30 Uhr zu schliessen.
Wir gehen davon aus, dass die Stromversorgung morgen wieder verfügbar ist und wir wie gewohnt zu erreichen sind.
Als pathologische Internet-Junkies werden wir natürlich unsere E-Mails über Handy, Pads & Co. auch am Nachmitag abrufen und (in dringenden Fällen) auch antworten.
Wir danken für Ihr Verständnis!
Wegen einer (nicht nachvollziehbaren) Störung sind unsere Telefonnummern heute (28.07.2016) nur eingeschränkt (bzw. gar nicht) in Betrieb.
Wir bemühen uns, die Störung so schnell wie möglich zu beseitigen bzw. die Telekom anzubetteln, die Störung so schnell wie möglich zu beseitigen.
Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie uns auch unter der
089 / 21 88 92 8-0
bzw. per E-Mail info@bpm-legal.de
erreichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Update 29.07.2016: Unsere Leitung ist weiterhin gestört! Da mittlerweile nahezu jeder die gleichen Erfahrungen mit dem Störungs- bzw Kundendienst der Deutschen Telekom gemacht haben dürfte und deswegen ein sehr genaues Bild über den Verlauf solcher Kommunikation hat, sehen davon ab, die Gesprächprotokolle mit der potenz-produkte.net/ Telekom zu veröffentlichen. Aber seien Sie versichert: es ist genauso kafkaesk, wie Sie es sich vorstellen!
Update 03.08.2016: Wir sind seit gestern (02.08.2016, ab ca. 15.00 Uhr) wieder vollumfänglich telefonisch erreichbar.
Die Frage nach der rechtlichen Beurteilung von Streetart finde ich besonders spannend. Nicht, dass ich sonderlich viele Fälle aus diesem Bereich zu bearbeiten hätte. Aber hier wird für mich ein Dilemma des Rechts besonders deutlich: Wie kann das bestehende Rechtssystem den Konflikt zwischen öffentlicher Kunst und fremden Eigentum lösen? Welches Grundrecht zählt mehr, die Kunstfreiheit oder das Eigentum? Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen, dürfte sich irren. Eine richtige Antwort gibt es nicht. Das Recht kann diesen Konflikt nicht lösen. Und das führt zu absurden Ergebnissen.
Ein Fall wie er in einer juristischen Klausur vorkommen könnte:
Die renommierte Kölner Künstlerin K., bekannt unter dem Pseudonym Catwoman, fühlt sich durch den Schmutz in ihrem Atelier in ihrer Kreativität beeinträchtigt. Sie will das Atelier deshalb einem gründlichen Frühjahrsputz unterziehen. Hierzu erwirbt sie in einem Fachgeschäft verschiedene Reinigungsmittel, darunter ein hochwirksames Lösungsmittel. Auf dem Rückweg kommt sie an der Villa des bekannten Kunsthändlers C. vorbei, die von einer langen Mauer umrundet wird. Die Mauer ist nach vielen Jahren der Vernachlässigung völlig verrußt. Catwoman empfindet diese Vernachlässigung als infam. Sie nimmt deshalb Lappen und Lösungsmittel und beginnt die Mauer an verschiedenen Stellen zu reinigen. Als ihr das Lösungsmittel ausgeht, stellt sie fest, dass sie nur Teile der Mauer reinigen konnte. Gerade als sie zusammenpacken will, um neues Lösungsmittel zu kaufen, kommt eine Polizeistreife vorbei. Die Streifenbeamten stellen fest, dass durch das partielle Reinigen der Mauer die Zeichnung eines weinenden Mädchens entstanden ist. Die Polizisten nehmen K. fest.
Frage: Hat K. sich strafbar gemacht?
Das Blog meines geschätzten Kollegen und Partners Peter Müller, www.muepe.de, wurde erfreulicherweise (= endlich) nominiert als bestes Jurablog 2014 (Kategorie IT, IP, Medien) bei kartellblog.de. Unter muepe.de werden seit über zehn Jahren regelmässig Beiträge zu aktuellen Urteilen und Entwicklungen im Bereich Markenrecht, Domains veröffentlicht. Damit gehört Peter Müller zu den Urgesteinen der Legal-Blogger.
Wir freuen uns über Ihre Stimme!
Kleiner Freitagsbeitrag zum Schmunzeln: Dreister Betrug Farmville-Bauern greifen Agrarsubventionen ab
via Dreister Betrug: Farmville-Bauern greifen Agrarsubventionen ab | Themen | PULS.
Mit Urteil vom 12.09.2013, Az I ZR 208/12 bestätigt der BGH die bisherige Rechtsprechung der Instanzgerichte zur Tell-a-Friend-Werbung (wir berichteten hier und hier). Demnach sind Weiterempfehlungen per Tell-a-friend-Funktion, die auf den Webseiten bereitgehalten werden, als Werbung einzustufen und können, wenn unverlangt versandt, als unzulässig eingestuft werden.
Schafft ein Unternehmen auf seiner Website die Möglichkeit für Nutzer, Dritten unverlangt eine sogenannte Empfehlungs-E-Mail zu schicken, die auf den Internetauftritt des Unternehmens hinweist, ist dies nicht anders zu beurteilen als eine unverlangt versandte Werbe-E-Mail des Unternehmens selbst. Richtet sich die ohne Einwilligung des Adressaten versandte Empfehlungs-E-Mail an einen Rechtsanwalt, stellt dies einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar.